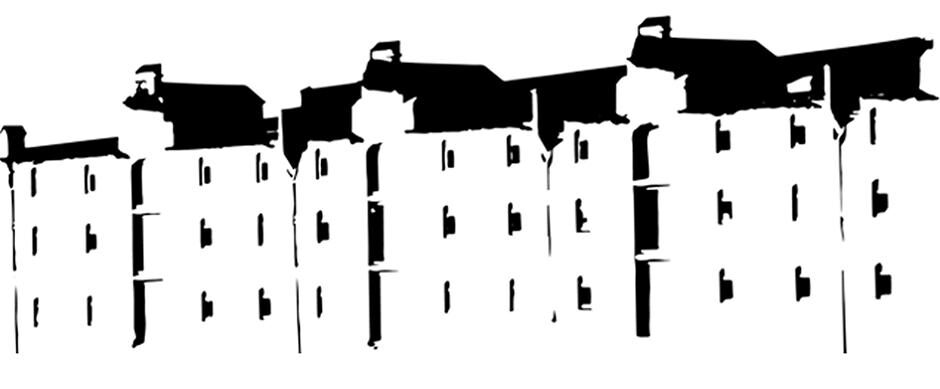Am Morgen des 12. November 2024 wurden drei Stolpersteine für die Italienischen Militärinternierten Aquilino Spozio, Ermino Fusa und Luige Fusi verlegt.
Am Abend haben wir auf Einladung von Holger Artus und der Projektgruppe Italienische Militärinternierte eine Rede gehalten.
„Auch wir begrüßen euch herzlich auf dieser Veranstaltung, danke dass ihr gekommen seid.
Wir sind von der Initiative Dessauer Ufer. Wir haben uns 2017 zusammengeschlossen, um uns für einen Gedenk- und Lernort im Lagerhaus G einzusetzen.
An diesem Ort waren etwa 6.000 Italienische Militärinternierte untergebracht. Es war das größte Internierungslager in Hamburg. Hier befand sich auch eines der größten KZ-Außenlager Hamburgs. Im Juli 1944 wurden 1.500 Frauen aus Auschwitz hierhin deportiert. Ab September 1944 wurden etwa 2.000 männliche Häftlinge aus dem Stammlager Neuengamme hierher gebracht.
Insgesamt eine halbe Million Menschen, Zwangsarbeiter*innen aus Osteuropa, Zivilist*innen aus anderen besetzten Gebieten, sowjetische Kriegsgefangene und Italienische Militärinternierte wurden unter menschenunwürdigen Bedingungen gezwungen, die Trümmer in der bombardierten Mineralölindustrie im Hafen zu räumen und zu weiteren Arbeiten in und um Hamburg, für die Stadt aber auch für privatwirtschaftliche Unternehmen eingesetzt.
Die Dessauer Straße, in der wir jetzt stehen, war dabei zentral für die Verteilung von Zwangsarbeiter*innen im Hamburg Hafen. Die 1921 in einer nordböhmischen Kleinstadt geborene Margit Hermannova, die 1944 in das Außenlager im Lagerhaus G deportiert wurde, beschreibt ihre Zeit in Hamburg:
“Hamburg, diese stolze, reiche Hafenstadt gleicht einer heruntergekommenen Schönen, deren Leib Wunden und Schwären bedecken und deren schmutziger Unterrock auf Schritt und Tritt hervorlugt. Überall sind Lager, Kriegsgefangenen- und Arbeitslager, große und kleine KZs. Ganze Viertel liegen in Schutt und Asche […].
Längs der eilig freigeschaufelten Straßen erheben sich hohe Schutthalden, unter denen noch unbegrabene Leichen liegen. Zwischen den Ziegeln und Steinen stecken hie und da kleine Holzkreuze – Wegweiser zu den Toten. […]
Die Stadt gibt nicht auf. Nach jedem Fliegerangriff setzen fieberhafte Aufräumungsarbeiten ein. Schutt wird weggeschaufelt, um die Straßen freizulegen. Blindgänger werden entschärft, heile Ziegel aussortiert und beschädigte zermahlen und zu Bausteinen verarbeitet. Was gestern zerstört wurde, wird heute mit Bienenfleiß wieder aufgebaut. Wer tut diese Arbeit? Häftlinge, Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter aus allen Ländern im Machtbereich Hitlers.
Überall kleben Plakate mit der Aufschrift ‘Alle Räder rollen für den Sieg’ und die Flüsterpropaganda ergänzt leise den Slogan mit dem Spruch ‘und viele Köpfe nach dem Krieg’.
Die Kinder des versklavten Europas lassen die Räder rollen, wenn auch nicht aus freien Stücken. Jammergestalten aus dem Fuhlsbütteler Zuchthaus, KZ-Häftlinge beiderlei Geschlechts in gestreifter Kluft, […] Italiener […] in zerrissenen grau-grünen Uniformen, mit der Aufschrift “MI” (Militärinternierte). […]
Wir begegnen […] Franzosen, die uns zuwinken. Manche tragen schwarze Barette, manchen baumeln winzige Quasten an der Mütze. Wir sehen […] Holländer und Vlamen und die Gruppe “OST”, Männer und Frauen im Lumpen, die häufig nicht einmal Schuhe besitzen. Sie schlurfen dahin mit gesenkten Köpfen, die Blicke zu Boden gerichtet, wie verprügelte Hunde.
Die Frauen tragen eingeschlagene Kopftücher, die ihre Stirn bis zu den Augenbrauen verhüllen. Alle verrichten Schwerarbeit, ohne Ruhepause, und sie schweigen beharrlich, als verstünden sie die Aufschrift auf den Plakaten, die an allen Häuserecken kleben.” (Harburger Jahrbuch, S. 176-178)
Diese Begegnungen, Kontakte oder Beziehungen zu anderen Verfolgten beschreiben auch viele andere Frauen des KZ-Außenlagers in ihren Erinnerungsberichten. Diese Begegnungen waren so wertvoll, weil die Frauen für die Nazis auf der untersten Stufe der rassistischen und antisemitischen Hierarchie standen. Das Zusammentreffen der Italienischen Militärinternierten und der jüdischen Frauen am Dessauer Ufer führte zu vielfältiger Hilfe und steht in besonderem Kontrast dazu, wie selten die Frauen durch deutsche Wachleute, Vorarbeiter, Aufseherinnen oder auf der Straße eine menschenwürdige Behandlung erfahren haben.
Während in Deutschland die Erinnerung an vermeintliche deutsche „Trümmerfrauen“ Allgemeingut ist, sind die unterschiedlichen Formen von Zwangs- und Sklavenarbeit, die unter aller Augen mitten in der Stadt verrichtet werden musste, nicht vergessen, aber doch gründlich verdrängt.
Wir sind der Meinung, dass es dringend einer Auseinandersetzung und Erinnerung an diese halbe Million Menschen in Hamburg braucht. Von unermüdlichen Aktivist*innen wie denen der „Projektgruppe Italienische Militärinternierte in Hamburg 1943-1945″ erkämpfte Gedenkzeichen wie diese Stolpersteine sind für uns daher erst der erste Schritt. Langfristig braucht es aus unserer Sicht einen Gedenk- und Lernort, der sich mit der Geschichte nationalsozialistischer Zwangsarbeit in Hamburg befasst.
Und welcher Ort wäre dafür besser geeignet, als das einzige vollständig baulich erhaltene Gebäude, in dem sich nicht nur eines der größten KZ-Außenlager Hamburgs befand, sondern auch ein Lager für Italienische Militärinternierte, mit weiteren Lagern für osteuropäische Zwangsarbeiter*innen in unmittelbarer Nachbarschaft.
1945, als auch den Letzten klar wurde, dass die Nationalsozialsten den Krieg nicht mehr gewinnen würden, ließ die Stadt ihre KZ-Außenlager räumen, damit der Ruf der Stadt, die so umfangreich von der Arbeit der hungernden Häftlinge profitiert hatte, bloß nicht durch deren Anwesenheit beschädigt würde. Über 80 Jahre später muss aus unserer Sicht Schluss sein mit der Verdrängung und durch die Stadtgesellschaft. Wir brauchen einen Gedenk- und Lernort am Dessauer Ufer.
Wenn wir in die Gegenwart schauen, merken wir sicherlich alle, dass diese 80 Jahre Verdrängung und die Kontinuitäten über 1945 hinweg nicht spurlos an dieser Gesellschaft vorüber gegangen sind. Wir leben in einer post-nationalsozialistischen Gesellschaft, die nach wie vor durch Ausgrenzung und Abwertung und durch Rassismus und Antisemitismus geprägt ist. Gedenken und Erinnerung an die Geschichte der Zwangsarbeit bedeutet deshalb für uns auch eine kritische Auseinandersetzung mit der Gegenwart. Auch das muss aus unserer Sicht Platz im Lagerhaus G finden.
Wir fordern deshalb über eine Gedenkstätte hinaus im Lagerhaus G Platz zu schaffen, für antifaschistische Auseinandersetzungen mit der Gegenwart, sei es in Form von Initiativen, Bildungsprojekten oder Kunstprojekten. Wir laden euch alle ein, diese heute verlegten Stolpersteine nicht nur zu einem Moment des Innehaltens zu nutzen, sondern zum Ausgangspunkt für eine tiefere und dauerhafte Auseinandersetzung mit der Geschichte nationalsozialistischer Zwangsarbeit in Hamburg und den Fragen, die sich daraus für unsere Gegenwart ergeben.“